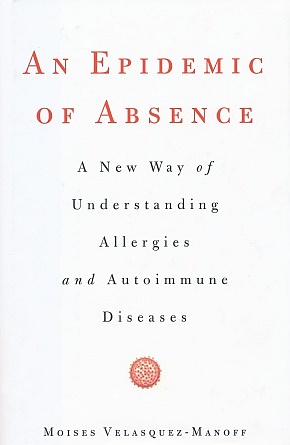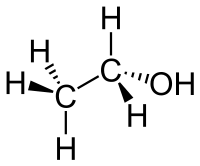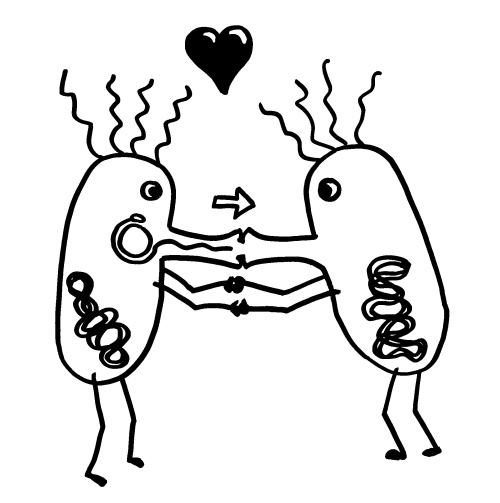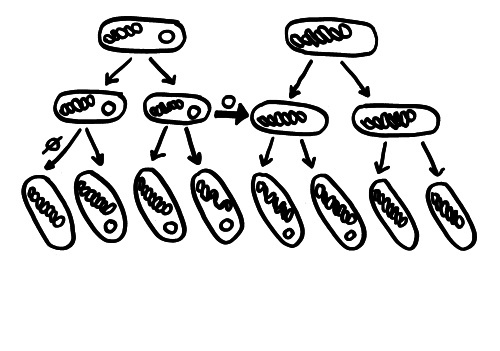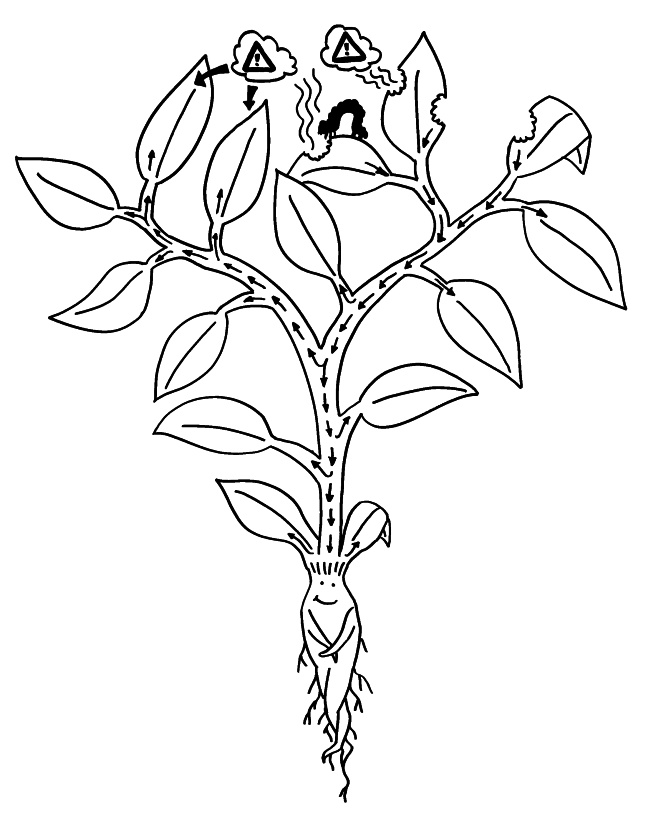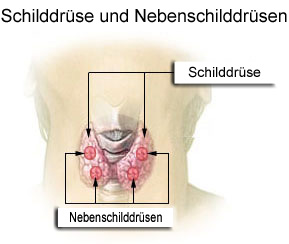Chronologische Sammelbesprechung von fünf Arbeiten aus den letzten 30 Jahren; noch nicht allgemeinverständlich aufbereitet; Anlass der Recherche war mein erster (und hoffentlich letzter), harmloser und kurzer Migräne-Anflug mit Aura vorletzte Woche:
Norman Geschwind, Peter Behan: Left-handedness: Association with immune disease, migraine, and developmental learning disorder. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 1982, 5097-5100
Eine damals aufsehenerregende Arbeit, in der die aus klinischen Beobachtungen gewonnene Hypothese getestet werden sollte, dass bei Linkshändern und ihren Angehörigen Autoimmunerkrankungen, Migräne und Lernschwierigkeiten wie Dyslexie gehäuft auftreten. In zwei voneinander unabhängigen Studien wurden Immunstörungen und Lernschwierigkeiten bei Linkshändern deutlich häufiger festgestellt als bei Rechtshändern. In einer dritten Studie wurde der Linkshänderanteil bei Menschen mit Migräne bzw. der Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis mit dem Linkshänderanteil in einer Kontrollgruppe aus der Allgemeinbevölkerung verglichen; er war höher. Weiterlesen