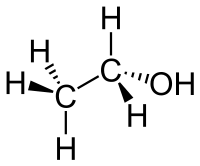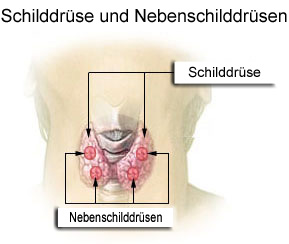Ein Buchkapitel – für mich überwiegend nur am Rande interessant (wegen der Ansicht einiger Autoren, Bell’s palsy sei eine mononeuritische GBS-Variante), aber gute, einfache Darstellung des Grundmodells (Abb.):
M. Mäurer et al. (2012): Immunneuropathien. In: M. Stangel und M. Mäurer, Autoimmunerkrankungen in der Neurologie, Springer
Sowohl dem Guillain-Barré-Syndrom (GBS) als typischer akuter inflammatorischer Neuropathie als auch der chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie (CIDP) liegen Autoimmunreaktionen gegen Myelin zugrunde. Lymphozyten und Makrophagen dringen in die peripheren Nerven ein (Infiltration). Primär meist Demyelinisierung, sekundär Schädigung der Axone. Tiermodell: experimentelle autoimmune Neuritis (EAN), die durch Immunisierung von genetisch anfälligen Versuchstieren mit peripherem Myelin, Myelinprotein P2 oder einer Peptidsequenz daraus oder mit den Myelinproteinen P0, MBP, PMP oder MAG ausgelöst wird. Molekulare Mimikry bei GBS, analog zu MS: Antigenpräsentierende Zellen (APCs) präsentieren auf ihren MHC-II-Molekülen Epitope, die Myelinstrukturen sehr ähneln -> Aktivierung und klonale Expansion naiver T-Zellen, die auch Myelin attackieren – z. B. nach Campylobacter-jejeuni-Infektionen. Bei etwa der Hälfte der GBS-Patienten Antikörper gegen Ganglioside (in Zellmembran verankerte Sphingolipide) gefunden, die als „lipid drafts“ für die Nervenimpulsübertragung wichtig sind. Je nach GBS-Variante andere Antigangliosid-Antikörper. Aus Patienten isolierter C.-jejeuni-Keime exprimieren Lipooligosaccharide (LOS), die den Kohlenwasserstoffanteilen der Ganglioside ähneln. Antikörper kreuzreaktiv, erkennen also sowohl die LOS als auch die Gangliosid-Komplexe. Bei GBS aber auch Antikörper gegen andere Glykolipide und Myelinproteine nachgewiesen; Zielstruktur also noch unklar. Weiterlesen