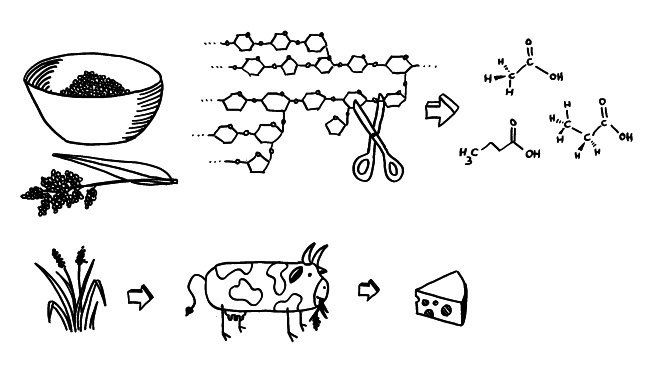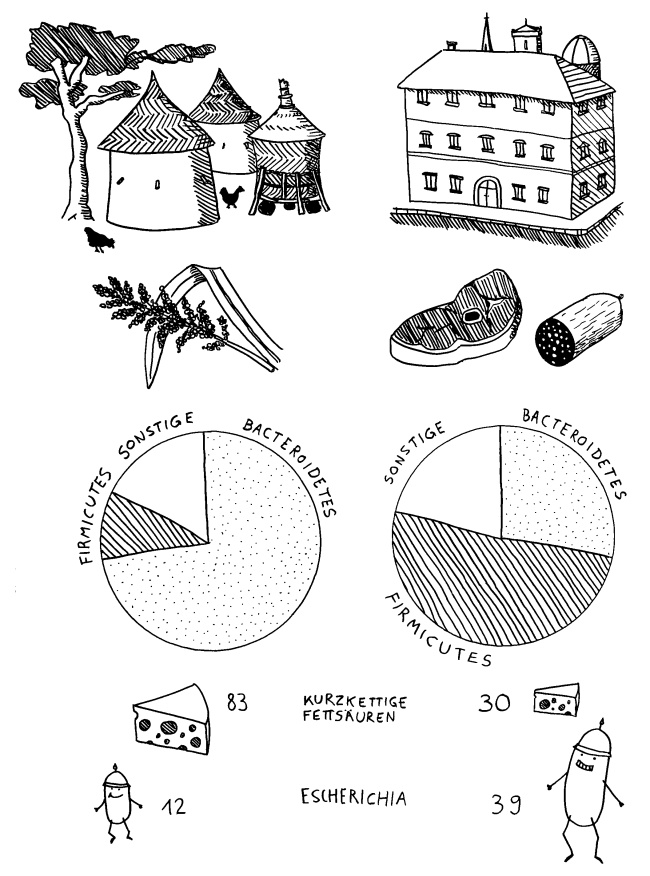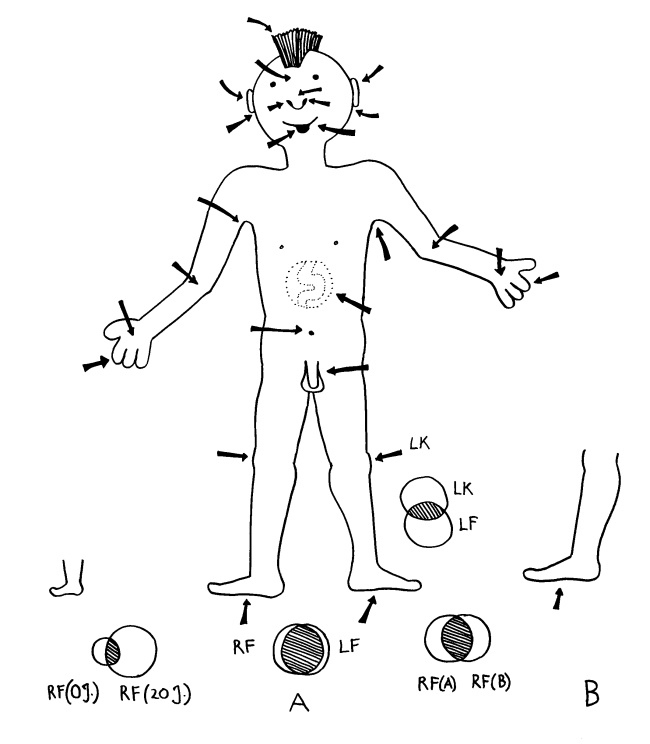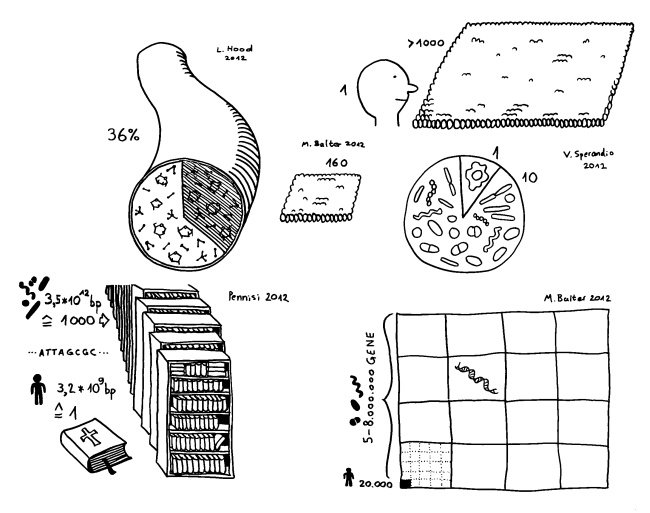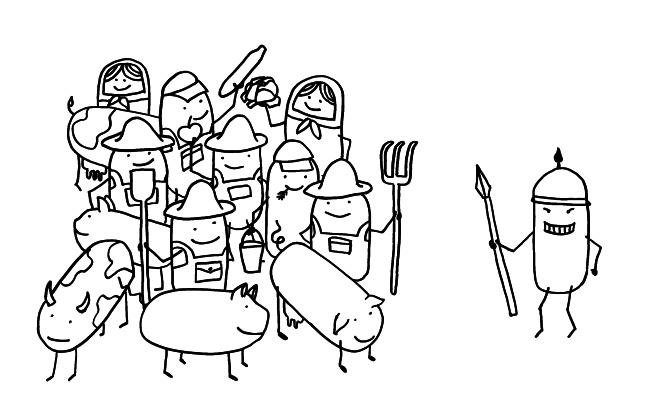Zusammenfassung des AIE-Aspekts der Arbeit:
Yun Kyung Lee und Sarkis K. Mazmanian: Has the microbiota played a critical role in the evolution of the adaptive immune system? Science 330(6012), 2010, doi: 10.1126/science.1195568
Außer den natürlichen Tregs (CD4+Foxp3+-T-Zellen aus dem Thymus) entstehen imVerdauungstrakt auch induzierbare Tregs aus naiven T-Zellen; einige davon produzieren entzündungshemmendes IL-10. Darmbakterien können an der Differenzierung einiger dieser Tregs beteiligt sein. Kommensalen wie Bifidobacterium infantis und Faecalibacerium prausnitzii können auch Foxp3+-Tregs und die IL-10-Produktion im Darm anregen – vermutlich, um in der Schleimhaut Toleranz zu induzieren. Weiterlesen